
Anna Carnap ist Erziehungswissenschaftlerin mit den Schwerpunkten Praxis- und Subjektivationstheorie, rekonstruktive Methoden, Schule, Medien, Macht und Kritik.
Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin (postdoc) am Institut für Erziehungswissenschaften der Humboldt-Universität zu Berlin im Arbeitsbereich Allgemeine Grundschulpädagogik.
In ihrer Doktorarbeit „Geschlechtlichkeit und pädagogisches Handlungswissen“ (Budrich, 2022) hat sie implizite wie explizite Geschlechterwissensbestände von Lehrer*innen ausgehend von Fotogruppendiskussionen mit künstlerischen Portraitfotografien rekonstruiert mit dem Ergebnis, dass die Relevantsetzung von Geschlechtlichkeit im Handlungswissen der Beforschten eine bestimmte, professionsgebundene Funktion erfüllt. Die Arbeit mit Bildern im Erhebungssetting sowie bei der Auswertung hat zu einer gegenstandsangemessenen Komplexitätssteigerung beigetragen, nämlich imaginäre und symbolische Aspekte aufeinander beziehen zu können.
Themenbezogene Publikationen:
Carnap, A. (2022): Geschlechtlichkeit und pädagogisches Handlungswissen. Eine rekonstruktive Studie zum schulischen Raum des Sicht- und Sagbaren. Opladen: Barbara Budrich. https://doi.org/10.2307/j.ctv2w61b33.1 (open access)
Carnap, A., Flasche, V., & Kramer, M. (2022): Posieren oder Sich-Positionieren. Die Rekonstruktion von Haltungen in jugendlichen Social-Media-Praktiken. In: J. Engel, T. Fuchs, C. Demmer, & C. Wiezorek (Hrsg.), Haltungen. Zugänge aus der Perspektive qualitativer Bildungs- und Biographieforschung. Opladen: Budrich.
Jörissen, B., Schröder, M. K., Carnap, A. (2020). Postdigitale Jugendkultur. In: Timm, Susanne/ Costa, Jana/ Kühn, Claudia/ Scheunpflug, Annette (Hrsg.), Kulturelle Bildung. Waxmann, S. 61-78.
Carnap, A., & Flasche, V. (2020): Diskursive Sichtbarkeiten – Aufführungen von Geschlechtlichkeit in (post)digitalen Jugendkulturen. In Geschlecht und Medien. Räume, Deutungen, Repräsentationen, herausgegeben von Britta Hoffahrt, Eva Reuter und Susanne Richter, Frankfurt/M. u. New York: Campus Verlag.
Weitere Informationen: https://www.erziehungswissenschaften.hu-berlin.de/de/institut/abteilungen/allgemeine-grundschulpaedagogik/allgemeine-grundschulpdagogik/team/dr-anna-carnap

Claudia Dreke ist Professorin für Sozialpädagogik und Soziologische Grundlagen in den Angewandten Kindheitswissenschaften an der Hochschule Magdeburg-Stendal.
Ihre derzeitigen Forschungsschwerpunkte sind Kinder und Kindheit in gesellschaftlichen Umbrüchen bzw. Fragen nach Veränderungs- und Beharrungstendenzen der Institution Kindheit in gesellschaftlichen Umbrüchen sowie nach entsprechenden sozialen Positionierungen von Kindern. In diesem Zusammenhang organisierte sie die Jahrestagung „Kinder und Kindheit in gesellschaftlichen Umbrüchen“ der Sektion Soziologie der Kindheit in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie mit (10/2018, Stendal). Ein weiterer Fokus liegt auf generationalen (Macht-)Verhältnissen in kindheitspädagogischen Institutionen.
Im Kontext des wissenschaftlichen Netzwerkes interessiert sie sich u.a. für subjektive Verarbeitungsformen von Umbrüchen in Kinderzeichnungen im (dialektischen) Verhältnis zu objektivierten Wissensbeständen.
Themenbezogene Publikationen:
Carnap Anna/Dreke, Claudia/Gall-Prader, Maria/Kanter, Heike/Philipps, Axel/Stölting, Erhard/Stützel, Kevin/Wopfner, Gabriele (2015). Die ‚rechte Mitte‘ im Bild – Eine rekonstruktive Bildanalyse zum NSU. In: sozialersinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung, 16(1), S. 3-25.
Dreke, Claudia (2016): Agency. Educators’ imaginations as triggered by photographs of pre-school children. In: M. S. Baader; T. Betz; F. Eßer & B. Hungerland (Hrsg.): Reconceptualizing Agency and Childhood: New Perspectives in Childhood Studies. Routledge: London & New York. S. 227-242.
Dreke, Claudia (2017): Kinder als Akteure? Eine Analyse von Fotos aus der pädagogischen Dokumentation eines Kindergartens. In: J. Borke; A. Schwentesius,; E. Sterdt (Hrsg.): Berufsfeld Kindheitspädagogik. Aktuelle Erkenntnisse, Projekte und Studien zu zentralen Themen der Frühen Bildung. Carl Link: Köln. S. 27-48.
Dreke, Claudia (2022): Imaginationen von Volk, Staat und Nation: DDR-Schülerzeichnungen aus der Umbruchszeit von 1989/90. In: Dies./ Hungerland, Beatrice (Hrsg.): Kindheit in gesellschaftlichen Umbrüchen. Weinheim & Basel: Beltz Juventa, S. 75-101.
Dreke, Claudia/ Hungerland, Beatrice/ Stölting, Erhard (2021): Einleitung: Kindheitsmuster und die Erfahrung gesellschaftlicher Umbrüche. In: Dies./ Hungerland, Beatrice (Hrsg.): Kindheit in gesellschaftlichen Umbrüchen. Weinheim & Basel: Beltz Juventa, S. 9-39.
Dreke, Claudia/ Hungerland, Beatrice (2021) (Hrsg.): Kindheit in gesellschaftlichen Umbrüchen. Weinheim & Basel: Beltz Juventa.

Viktoria Flasche ist Junior Professorin für Pädagogik an der Kunstakademie Düsseldorf. Zwischen 2015 und 2022 betreute sie BMBF-geförderte Forschungsprojekte am Lehrstuhl für Pädagogik mit dem Schwerpunkt Kultur und Ästhetische Bildung an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ihre Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Jugendforschung mit dem Fokus auf Subjektivierungsprozesse – insbesondere im Hinblick auf Social Media – und rekonstruktiven Ansätze der Sozial- und Kunstwissenschaft.
Im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerkes gilt ihr Interesse transgressiven Bildpraktiken, die im Rahmen tiefgreifender Mediatisierung und Digitalisierung auch Forschungsgegenstände und -fragen transformieren.
Jun.-Prof.in Dr. Viktoria Flasche: Kunstakademie Düsseldorf, Eiskellerstr. 1, 40213 Düsseldorf viktoria.flasche@kunstakademie-duesseldorf.de
Themenbezogene Publikationen:
Flasche, V./ Carnap, A. (2021): Zwischen Optimierung und ludischen Gegenstrategien – Ästhetische Praktiken von Jugendlichen an der Social Media Schnittstelle. In: Zeitschrift für MedienPädagogik, 40. 259-280. https://doi.org/10.21240/mpaed/42/2021.06.22.X
Flasche, V. (2021): Powerful Entanglements: interrelationships between platform architectures and young people’s performance of self in social media. In: P. Bettinger (Ed.): Educational Perspectives on Mediality and Subjectivation. Discourse, Power and Analysis. Palgrave Macmillian: London. https://www.palgrave.com/gp/book/9783030843427#aboutBook. doi.org/10.1007/978-3-030-84343-4_5
Flasche, V. (2019): Bild(e)bewegungen. Annäherungen an jugendliche Artikulationen des Selbst in den Social Media. In: Zeitschrift Kunst – Medien – Bildung| zkmb 2019. http://zkmb.de/bildebewegungen-annaeherungen-an-jugendliche-artikulationen-des-selbst-in-den-social-media/#link1
Flasche, V. (2020). Hinter den Spiegeln – Ikonische Selbstthematisierungen im Netz. In:
J.Fromme, S. Iske, D. Verständig & K. Wilde: Big Data, Datafizierung und digitale Artefakte,
Wiesbaden: VS. (Im Erscheinen)
Flasche, V. (2017): Jugendliche Bricolagen – Eine Spurensuche zwischen digitalen und
analogen Räumen. In M. Pietraß, J. Fromme, P. Grell & Th. Hug (Hrsg.): Jahrbuch der
Medienpädagogik 14: Der digitale Raum. Wiesbaden: VS. S. 35-54.

Heike Kanter ist Soziologin und Bildredakteurin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Methodologie und Methoden der qualitativen Bildforschung, Migration und DDR. Außerdem lehrt sie zur Theorie und Praxis von Bildern an (Fach-)Hochschulen und in der Erwachsenenbildung mit besonderem Fokus auf eine kritisch-politische Bildarbeit.
Im Rahmen des Netzwerkes gilt ihr Interesse der steten Relationierung von Theorie und Gegenstand über eine rekonstruktive Forschungspraxis.
Auswahl themenbezogene Publikationen:
Kanter, Heike, Köffler, Nadja & Brandmayr, Michael (2021). Bilder, soziale Medien und das Politische. Transdisziplinäre Perspektiven auf visuelle Diskursprozesse. Bielefeld: transcript: Open Access
Kanter, Heike. (2021). Medienberichterstattung zum NSU-Komplex: Wie die Mordopfer des NSU in den Blick geraten(Überblickstext). In: Vom Lernen und Verlernen. Methodenhandbuch zur rassismuskritischen Aufarbeitung des NSU-Komplex. H. Zimmermann/M. Klaus (Hrsg.) im Rahmen des Projektes Offener Prozess in Trägerschaft des ASA-FF e.V. und in Kooperation mit der Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. (NDC Sachsen).Chemnitz, S. 53-55.
Kanter, Heike. (2021). Die Opfer des NSU im Blick der Presse (Methodentext). In: Vom Lernen und Verlernen. Methodenhandbuch zur rassismuskritischen Aufarbeitung des NSU-Komplex. H. Zimmermann/M. Klaus (Hrsg.) im Rahmen des Projektes Offener Prozess in Trägerschaft des ASA-FF e.V. und in Kooperation mit der Courage-Werkstatt für demokratische Bildungsarbeit e.V. (NDC Sachsen).Chemnitz, S. 115-119.
Kanter, Heike (2020). „Politische“ Bilder bewusst einsetzen – Anregungen für den Einsatz von visuellen Materialien im Unterricht zur Schulung eines kritisch-reflexiven Sehens. In: Erziehung & Unterricht 1/2020.
Kanter, Heike/Koltermann, Felix (2020). Astro-Alex auf dem Weg zur ISS: Kontextwandel bildjournalistischer Kommunikation im digitalen Journalismus. In: Brantner, Cornelia/Götzenbrucker, Gerit/Lobinger, Katharina/Schreiber, Maria (Hrsg.), Vernetzte Bilder. Visuelle Kommunikation in Sozialen Medien. Köln: Halem.
Kanter, Heike/Pilarczyk, Ulrike (2018). The Wasted Youth. Bilder von Jugend/lichkeit im 21. Jahrhundert. In: Zeitschrift für Pädagogik. 64 (3), S. 290-306
Kanter, Heike (2018) Die Dokumentarische Methode: methodologische Grundlagen und interpretative Forschungspraxis am Beispiel der Analyse ‚öffentlicher Bilder‘. In: Akremi, L./ Baur, N./Knoblauch, H./Traue, B. (Hrsg.), Interpretativ Forschen. Ein Handbuch für die Sozialwissenschaften. Weinheim/München: Juventa, S. 315-341.
Kanter, Heike (2017). Soziologische Kurzsichtigkeit? Was Bilder zum Erforschen von Gesellschaft beitragen können. In: https://soziopolis.de/verstehen/was-tut-die-wissenschaft/artikel/soziologische-kurzsichtigkeit/
Kanter, Heike (2016). Ikonische Macht. Zur sozialen Gestaltung von Pressebildern. Opladen/Berlin/ Toronto: Budrich. Open Access
Carnap Anna/Dreke, Claudia/Gall-Prader, Maria/Kanter, Heike/Philipps, Axel/Stölting, Erhard/Stützel, Kevin/Wopfner, Gabriele. Die ‚rechte Mitte‘ im Bild – Eine rekonstruktive Bildanalyse zum NSU. In: sozialersinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung, 16(1), S. 3-25.
Weitere Informationen:

Nicole Kirchhoff ist Soziologin/Erziehungswissenschaftlerin/Redakteurin im Bereich Printmedien
- Wissenschaftliche Mitarbeiterin/Koordinatorin der Interdisziplinären Profilierung „Diversität, Gesundheit und Versorgung“ an der Medizinischen Fakultät der Universität Bielefeld
- Journalistisch tätig bis einschl. 2009
- Arbeitsschwerpunkte: Soziologie des Körpers und des Geschlechts, Methoden der qualitativen Sozialfoschung, insbesondere der visuellen Soziologie, Soziologie der Jugend, Kindheit und Familie, Migration und Transnationalisierung E-Mail: nicole.kirchhoff@uni-bielefeld.de
- Dissertation zum Thema „Körperbilder und Bildkörper als soziale Praxis von Jugendlichen“als method(olog)ische Arbeit, die unter anderem der Frage nachgeht, wie der Körper und seine Verfasstheit als fraglose Gegebenheit des Menschseins und seiner Teilnahme am sozialen Alltag reflexiv verfügbar und so (s)einer sozialwissenschaftlichen Erforschung empirisch zugänglich gemacht werden kann
Themenbezogene Publikationen:
Kirchhoff, Nicole (2023): Der Krieg als Feld von ,Körpern im Ausnahmezustand“. In: Journal Netzwerk Frauen- und Geschlechterforschung NRW, S. 78-80
Kirchhoff, Nicole (2021): Körperbilder und Bildkörper als soziale Praxis von Jugendlichen. https://www.db-thueringen.de/receive/dbt_mods_00059331
Meuser, Michael & Kirchhoff, Nicole (2019): Kulturen und Praktiken des Körpers. In: Stephan Moebius et al. (Hrsg.): Handbuch Kultursoziologie, Bd. 2. Wiesbaden: Springer VS. doi:10.1007/978-3-658-08001-3_30
Euteneuer, Matthias & Kirchhoff, Nicole (2019). Montagen als Medium der sozialpädagogischen Erforschung familialer Alltagswelten. Eine exemplarische Diskussion visueller Forschungszugänge in der Sozialen Arbeit. In: Deutsches Jugend Institut (Hrsg.): Auf dem Weg zum Gegenstand im Forschungsfeld der Kinder- und Jugendhilfe: Methodologische Herausforderungen in der qualitativen Forschung. München: S. 16-37.
Kirchhoff, Nicole/Zander, Benjamin (2018): „Aussehen ist nicht wichtig!“ – Zum Verhältnis von Körperbildern und Körperpraktiken bei der Herstellung von Geschlecht durch männliche und weibliche Jugendliche. In: Gender. Zeitschrift für Geschlecht, Kultur und Gesellschaft, 10. Jahrgang 2018 • Heft 1., S. 81-99.
Kirchhoff, Nicole (2018): „Wir sind Gangster“: Körperbilder als Produkte von Darstellung und Wahrnehmung in Aufführungen von Geschlecht In: Wissensrelationen. Beiträge und Debatten zum 2. Sektionskongress der Wissenssoziologie. Weinheim/Basel: Beltz-Juventa, S. 872-884
Kirchhoff, Nicole (2016): Reden über den Körper als Handlungsproblem von Schüler/innen. Zur Erweiterung von Gruppendiskussionen durch Collagen und fotografische Selbst-Inszenierungen. Zeitschrift für Qualitative Forschung (ZQF), 17 (1-2), 107-131.

Johannes Marent (Mitarbeit im Netzwerk bis März 2022) ist Mitglied im Forschungsnetzwerk „Visual Studies“ an der Universität Wien und Lektor an der FH Joanneum in Graz. Seine Forschungsschwerpunkte sind Methoden der qualitativen Bildanalyse, visuelle Diskursanalyse, partizipative Forschungsmethoden sowie Stadt- und Migrationssoziologie.
Im Netzwerk fokussiere ich darauf wie symbolische Grenzziehungsprozesse bildmedial hergestellt werden. Dabei konzentriere ich mich vor allem auf die Darstellung von Räumen und Körpern.
Themenbezogene Publikationen:
Marent, Johannes (2016): Istanbul als Bild. Eine Analyse urbaner Vorstellungswelten, Bielefeld: Transcript.
Marent, Johannes (2016): Die Rückeroberung der Vergangenheit: Istanbuls visuelle Kommunikation zum Europäischen Kulturhauptstadtjahr 2010. In: ÖZS 41(2), S. 165-185.
Marent, Johannes (2015): Depicted Walks: An Exploration of Istanbul’s Imaginary. In: Bernard, Veronika (Hrsg.), IMAGES (IV) – Images of the Other. Istanbul, Vienna and Venice, Berlin, LIT Verlag: S. 71-84.
Marent, Johannes/Rosenbusch, Christoph (2014): Rhythmik in Bildern: Kompaktimpressionen. In: Frank, Sybille/Gehring, Petra/Griem, Julika, et al. (Hrsg.), Städte unterscheiden lernen. Zur Analyse interurbaner Kontraste: Birmingham, Dortmund, Frankfurt, Glasgow, Frankfurt a.M., Campus: S. 69-96.
Marent, Benjamin/Marent, Johannes (2013): Gesundheit und Wohlbefinden im Kontext jugendlicher Lebenswelten – Ergebnisse einer Photovoice-Studie. In: Prävention und Gesundheitsförderung 8(4), S. 276-283.
Weitere Informationen:
https://visualstudies.univie.ac.at
https://www.researchgate.net/profile/Johannes_Marent
https://unitrier.academia.edu/JohannesMarent
| johannes.marent@univie.ac.at

Ulrike Mietzner, Professorin für Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt Historische Bildungsforschung an der Technischen Universität Dortmund
Schwerpunkte von Lehre und Forschung: Erinnerung und Gedächtnis und ihre Medien, die Rolle von Geschichte für Gegenwart und Zukunft in einer heterogenen Gesellschaft, ästhetische Formen der Überlieferung und Vermittlung
Ich engagiere mich im Kuratorium des Deutschen Kinder und Jugendfilmzentrums für das Fotografieren von Kindern und Jugendlichen (https://www.kjf.de/) und im Kompetenzfeld Metropolenforschung für die Darstellung, Deutung, Aneignung und Gestaltung von metropolitanen Räumen (http://metropolenforschung.uaruhr.de/forschung/felder/deutung.html.de).
Im Netzwerk verfolge ich Schwerpunkte wie die intermedialen Bezüge von Bildern, Bildlichkeit und Erkenntnis sowie Fotografien als Quellen historischer Forschung – insbesondere in Hinblick auf bildlich starke Themen wie Körper und Geschlecht.
Themenbezogene Publikationen:
Mietzner, Ulrike (2018): Widerspenstige Körper. Nonkonformität und Eigensinn von Bewegung. In: Zeitschrift für Pädagogik 64 (2018) 1, S. 15-30.
Mietzner, Ulrike (2014): Bild. In: Wulf, Christoph/Zirfas, Jörg (Hrsg.), Handbuch Pädagogische Anthropologie. Wiesbaden: Springer VS. S. 465-474.
Mietzner, Ulrike (2015): Beobachtungen des Selbst und der Welt im Medium der Fotografie. Bildungstheoretische Überlegungen. In: Dörpinghaus, Andreas, Platzer, Barbara, Mietzner, Ulrike (Hrsg.), Bildung an ihren Grenzen. Zwischen Theorie und Empirie. Festschrift zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Lothar Wigger. Darmstadt: WBG, S. 125-142.
Mietzner, Ulrike (2021): Bildungstheoretische Reflexionen des Bildlichen. In: Kergel, David/Heidkamp-Kergel, Birte/August, Sven-Niklas (Hg.): Interdisziplinäre Bildungsforschung. Weinheim/Basel: Beltz Juventa, S. 285-295.
Mietzner, Ulrike (2021): Qualitative Methoden. In: Kluchert, Gerhard/Horn, Klaus-Peter/Groppe, Carola/Caruso, Marcelo (Hg.): Historische Bildungsforschung. Konzepte – Methoden – Forschungsfelder. Bad Heilbrunn: Klinkhardt, S. 127-136.
Mietzner, Ulrike (2022): WE_LOVE. Fotografieren in neuen Zeiten. In: Köffler, Nadja/Mietzner, Ulrike/Schmolling, Jan (Hg.): WE_LOVE. 60 Jahre Deutscher Jugendfotopreis. München: kopaed, S. 14-15.
Mietzner, Ulrike (2022): Beziehungsaufnahmen – Fotografieren auf Reisen zwischen Selbstverortung, Dokumentation, Kritik, Kommunikation und Traum. In: Knobloch, Philipp D. Th./Drerup, Johannes/Dipcin, Dilek (Hg.): On the Beaten Track. Zur Theorie der Bildungsreise im Zeitalter des Massentourismus. Metzler: Berlin, S. 57-71.
Weitere Informationen:

Axel Philipps ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz Center for Science and Society (LCSS) der Leibniz Universität Hannover. Am Forschungszentrum forscht er zum Sprachgebrauch in Forschungsanträgen sowie zur Einführung von randomisierten Verfahren in der Forschungsförderung. Seine Forschungsschwerpunkte sind Kultur-und Wissenssoziologie, Methoden der qualitativen Sozialforschung (im Besonderen Interview-, Text- und Bilddaten) sowie Modi des Widerständigen.
Im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerkes gilt sein Interesse dem Verhältnis von schriftlich festgehaltenen und visualisierten originären Forschungsideen.
Themenbezogene Publikationen:
Philipps, Axel und Leonie Weißenborn (2019): Unconventional ideas conventionally arranged: A study of grant proposals for exceptional research. Social Studies of Science, OnlineFirst, DOI:0306312719857156.
Philipps, Axel (2016): Das Problem des Bildsinns und der bildlichen Vielfalt in der Soziologie. Zur Bedeutung von materialen und medialen Gestaltungsmöglichkeiten für rekonstruktive Bildinterpretationen. Soziale Welt, 67(1): 5-22.
Philipps, Axel (2015): Visuelles Protestmaterial als empirische Daten. Zur dokumentarischen Bildinterpretation von Textbotschaften. In: Ralf Bohnsack; Burkard Michel und Aglaja Przyborski (Hrsg.), Dokumentarische Bildinterpretation. Methodologie und Forschungspraxis, Opladen: Budrich, 95-117.
Weitere Informationen: https://www.ish.uni-hannover.de/1900.html#c4144

Ulrike Pilarczyk,
Ulrike Pilarczyk, Dr. habil, Professorin für Erziehungswissenschaft an der TU Braunschweig, Institut für Erziehungswissenschaft
Schwerpunkt in Forschung und Lehre: Historische Bildungs- und Sozialisationsforschung, bildanalytische Forschungsmethoden
DFG-Forschungsprojekt (2018-2021): „Nationlajüdische Jugendkultur und zionistische Erziehung in Deutschland und Palästina zwischen den WEltkriegen“ und (2023-2025): „Zwischen ALija und Flucht. Jüdische Jugendbünde und zionistische ERziehung unter dem NS-Regime und im vorstaatlichen Israel 1933-1945“ Projektleitung in Kooperation mit der Hebrew University of Jerusalem, www.juedischejugendkultur.de
Foto-Ausstellung „…unter normalen Umständen wäre ich kein Bauer geworden…“ Jüdische Lehrgüter im Nationalsozialismus, Schulmuseum Steinhorst 4/2019-10/2019.
Schwerpunkt ihrer Interessen im Netzwerk ist Fotografie als historische Quelle mit besonderem Bezug auf Jugend/Jugendlichkeit/Medien im 20. Jahrhundert.
Themenbezogene Publikationen:
Pilarczyk, Ulrike (2024): Einmal Kibbuz und zurück. Zionistische Jugendbewegung zwischen Deutschland und Palästina 1926–1930. In: Jüdische Jugend im Übergang – Jewish Youth in Transit: Selbstverständnis und Ideen in Zeiten des Wandels, hrsg. von Knut Bergbauer, Nora M. Kissling, Beate Lehmann, Ulrike Pilarczyk und Ofer Ashkenazi, Berlin, Boston: De Gruyter Oldenbourg, pp. 21-58. Volltext (Open Acces) https://doi.org/10.1515/9783110774702
Pilarczyk, Ulrike (2019): “Chalutzim” – Zionist Photography in Germany and Palestine in the Thirties: A Comparative Analysis of Images, in: Leo Baeck Institute Yearbook 2019, DOI 10.1093/leobaeck/ybz009.
Pilarczyk, Ulrike (2018): Blickwechsel. Bildanalytische Perspektiven auf die jüdische Jugendbewegung in Deutschland und Palästina. In: Eckart Conze / Susanne Rappe-Weber (Hrsg.), Die deutsche Jugendbewegung. Historisierung und Selbsthistorisierung nach 1945. Göttingen 2018, S. 89-110.
Pilarczyk, Ulrike (2017): Grundlagen der seriell-ikonografischen Fotoanalyse – Jüdische Jugendfotografie in der Weimarer Zeit. In: Jürgen Danyel/Gerhard Paul/Annette Vowinckel (Hrsg.), Visual History als Praxis. Wallstein 2017, S. 75-99.
Pilarczyk, Ulrike (2014): Drinnen und Draußen. Ein bildanalytischer Rückblick auf Jugend in den 1980er Jahren. In: Te Heesen, K. u.a.(Hrsg.), Pädagogische Reflexionen des Visuellen. Münster 2014, S. 115-130.
Weitere Informationen:

Dr. Patricia Prieto-Blanco ist Dozentin an der Fakultät für Kunst und Sozialwissenschaften der Universität Lancaster (UK). Sie ist die stellevertretende Vorsitzende der ECREA-Section Visual Cultures, und Vorstandsmietglied der IVSA (International Visual Sociology Association), sowie Fachberaterin für interdisziplinäre, teilnehmende und praxisorientierte Forschung mit den Schwerpunkten visuelle Forschungsmethoden, Fotografie und Migration. Ihre Forschungsinteressen umfassen Fotografie, Fragen zur Methodologie und zu Verfahrensweisen, Mediatisierung/Mediation, Alltagskulturen und Migration. Zurzeit agiert Patricia Prieto-Blanco als internationale Beraterin in den folgenden drei Forschungsprojekten: 1) „What’s in the App? Digitally-mediated communication within contemporary multilingual families across time and space“ (University of Jyväskylä, Finland), und 2) „Visibilizando el dolor: narrativas visuales de la enfermedad y storytelling transmedia“ (Ministerio de Ciencia, Innovacion y Universidades, Spain).
Von der Mitwirkung im Netzwerk verspricht sich Patricia Prieto-Blanco anregende Diskussionen zum Thema (Un)Sichtbarkeit sowie einen konstruktiven Austausch über die Ethik und Praxis methodisch kontrollierter Bildinterpretationen.
Themenbezogene Publikationen:
Prieto-Blanco, Patricia (2021): Afterword: Visual Research in Migration. (In)Visibilities, Participation, Discourses. In: Nikielska-Sekula, K., Desille, A. (eds) Visual Methodology in Migration Studies. IMISCOE Research Series. Springer, Cham. pp. 327-343. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-67608-7_18
Gencel Bek, M. and Prieto-Blanco, P. (2020) (Be)Longing through visual narrative: Mediation of (dis)affect and formation of politics through photographs and narratives of migration at DiasporaTurk. International Journal of Cultural Studies, 23 (5), pp. 709-727. https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1367877920923356
Prieto-Blanco, Patricia (2018): Vizualne meditacije, zmožnosti in družbeni capital. Fotografija 80/81: 76-79.
Prieto-Blanco, Patricia und Akim, Y. (2018): Exploring self-identification through verbal and visual dialogue. MAI, 1. https://maifeminism.com/exploring-self-identification-through-verbal-and-visual-dialogue/
Prieto-Blanco, Patricia (2017): Understanding the Performative Power of Family Photographs through the work of John Clang, Liz Steketee and Trish Morrissey. In: Gómez-Pinto, J. and Matoso, R. (eds.), Art and Photography in Media Environments. Edições Universitárias Lusófonas, Portugal, 93-105
Weitere Informationen:

Tobias Schlechtriemen ist Kultursoziologe und arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Sonderforschungsbereich 948 „Helden – Heroisierungen – Heroismen“ und am Institut für Soziologie der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg.
Er beschäftigt sich mit der Rolle, die Bilder in der Gesellschaft wie auch beim Zustandekommen soziologischen Wissens spielen. Im Rahmen seiner Doktorarbeit hat er Metaphern der Gesellschaft untersucht, vor allem die Gesellschaft als Organismus in der Gründungszeit der Soziologie und das Bild der Netzwerkgesellschaft in neueren soziologischen Theorien. Die Promotion ist im Kontext des Graduiertenkollegs „Die Figur des Dritten“ an der Universität Konstanz und am NFS „Bildkritik – eikones“ der Universität Basel entstanden. In seinem Habilitationsprojekt entwickelt er eine „Figurative Soziologie“, die einerseits wissenschaftsgeschichtlich die Funktion figurativer Elemente in soziologischen Beschreibungen analysiert und andererseits deren Potential für soziologische Forschungen auslotet. Darüber hinaus untersucht er grundlegende kulturelle Sinngebungsprozesse, wie den Nachhaltigkeitsdiskurs und Prozesse der Heroisierung und Deheroisierung.
Im Rahmen des wissenschaftlichen Netzwerkes arbeitet er am soziologischen Konzept der Sozialfigur und untersucht dies am Beispiel der Sozialfiguren des Digitalen.
Themenbezogene Publikationen:
Schlechtriemen, T. 2024: „Social Figures as Elements of Sociological Theorizing”, in: Distinktion: Journal of Social Theory, DOI: 10.1080/1600910X.2023.2281233.
Schlechtriemen, T. 2022: „Die Bilder des Sozialen und ihre Rolle in der soziologischen Theoriebildung”, in: Soziologie. Forum der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 51 (2), S. 173-185.
Moser, S. J. und Schlechtriemen, T. (Hrsg.) von 11/2020 – 02/2021, „Sozialfiguren der Corona-Pandemie“, Reihe im Blog des Kulturwissenschaftlichen Instituts Essen (KWI).
Schlechtriemen, T. (2020): „Gezeichnete Evolutionstheorie. Herbert Spencers Grafiken zur Entwicklung der Natur“, in: Michael Gamper (Hrsg.), Ästhetische Eigenzeiten der Wissenschaften, Hannover: Wehrhahn, S. 227-265.
Herbrik, R. und Schlechtriemen, T. (Hrsg.) 2019: Einsatzpunkte und Spielräume des sozialen Imaginären in der Soziologie, Sonderheft 18 (2), Österreichische Zeitschrift für Soziologie, Wiesbaden: Springer VS.
Schlechtriemen, T. 2019: Sozialfiguren in soziologischen Gegenwartsdiagnosen, in: T. Alkemeyer / N. Buschmann / T. Etzemüller (Hrsg.), Gegenwartsdiagnosen. Kulturelle Formen gesellschaftlicher Selbstproblematisierung in der Moderne, Bielefeld: transcript, S. 147–166.
Schlechtriemen, T. / Moser, S. J. 2018: Sozialfiguren – zwischen gesellschaftlicher Erfahrung und soziologischer Diagnose, in: Zeitschrift für Soziologie 47, 3, S. 164–180.
Schlechtriemen, T. 2014: Bilder des Sozialen. Das Netzwerk in der soziologischen Theorie, Paderborn: Fink.
Weitere Informationen:
https://www.soziologie.uni-freiburg.de/personen/schlechtriemen

Sebastian Schönemann ist Soziologe und Politikwissenschaftler. Er arbeitete u.a. bei den Arolsen Archives als wissenschaftlicher Mitarbeiter und stellvertretender Leiter des Bereichs Forschung und Bildung sowie der Gedenkstätte für Zwangsarbeit Leipzig, für die er das Gedenkstättenkonzept verfasste. Seine Doktorarbeit „Symbolbilder des Holocaust. Fotografien der Vernichtung im sozialen Gedächtnis“ erschien 2019 im Campus-Verlag. Seit 2020 ist er Leiter Wissenschaft und Ausstellung sowie stellvertretender Leiter der Gedenkstätte Hadamar.
Seine Forschungsschwerpunkte umfassen die Methoden der qualitativen Sozialforschung, die soziologische und historische Gewaltforschung, die Gedächtnissoziologie sowie die Tradierungsformen von Geschichte.
Innerhalb des Netzwerkes gilt sein Interesse der Frage nach der Bedeutung des Bildes als historische Quelle und sinnstiftendes Symbol.
Themenbezogene Publikationen
Sebastian Schönemann: Erinnerndes Sehen, sehendes Erinnern – Bilder des Ghettos im sozialen Gedächtnis, in: Hans-Georg Soeffner et al. (Hg.): Theresienstadt. Filmfragmente und Zeitzeugenberichte. Historiographie und soziologische Analysen, Wiesbaden 2021, S. 227–240.
Sebastian Schönemann/Ann Katrin Düben: Gewalt als Leere. Repräsentation und Rezeption der Ikone des Torhauses Auschwitz-Birkenau, in: Franca Buss/Philipp Müller (Hg.): Hin- und Wegsehen! Erscheinungsformen der Gewalt im Kräfteverhältnis zwischen Bild und Betrachter, Berlin 2020, S. 181–193.
Sebastian Schönemann: Symbolbilder des Holocaust. Fotografien der Vernichtung im sozialen Gedächtnis, Frankfurt M./New York 2019.
Sebastian Schönemann: Repräsentation der Abwesenheit. Visualisierungen des Holocaust im sozialen Gedächtnis am Beispiel des Fotos vom Torhaus Auschwitz-Birkenau, in: Zeitschrift für Qualitative Forschung, Heft 1 + 2 2016, S. 41–57.
Weitere Informationen:
www.gedenkstaette-hadamar.de

Maria Schreiber ist Postdoc am Fachbereich Kommunikationswissenschaft der Universität Salzburg. Sie promovierte in Publizistik und Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien. Als Stipendiatin der Österreichischen Akademie der Wissenschaften war sie Teil des interdisziplinären DOC-Team-Projekts Bildpraktiken (http://bildpraktiken.wordpress.com). Sie war im Graduiertenkolleg “Sichtbarkeit und Sichtbarmachung” der Universität Potsdam zu Gast, weiters am Digital Ethnography Research Center der RMIT University in Australien. Als Postdoc arbeitete sie im Projekt Visuelle Biographien (https://visbio.univie.ac.at/) am Institut für Soziologie der Universität Wien.
Themenbezogene Publikationen
Schreiber, Maria (2017): Showing/Sharing: Analysing Visual Communication from a Praxeological Perspective. In: Media & Communication, Special Issue: “Visual Communication in the Age of Social Media: Conceptual, Theoretical and Methodological Challenges”. Vol 5 (4). p. 37-50. DOI: http://dx.doi.org/10.17645/mac.v5i4.1075
Schreiber, Maria (2017): Aesthetics, Audiences & Affordances. Analyzing platform-specific practices of sharing pictures. In: Digital Culture & Society, Special Issue: “Mobile Digital Practices: Situating People, Things and Data”. Vol 3 (2). p. 143-163. DOI: https://doi.org/10.14361/dcs-2017-0209
Schreiber, Maria (2016, mit Kramer Michaela): Verdammt schön. Methodologische und methodische Herausforderungen der Rekonstruktion von Bildpraktiken auf Instagram (Damn beautiful. Methodological and methodic challenges in reconstructing picture practices on Instagram). In: Materiale Visuelle Soziologie. Schwerpunktheft der Zeitschrift für qualitative Forschung. Vol 17 (1-2). p. 81-106. DOI: https://doi.org/10.3224/zqf.v17i1-2.25544
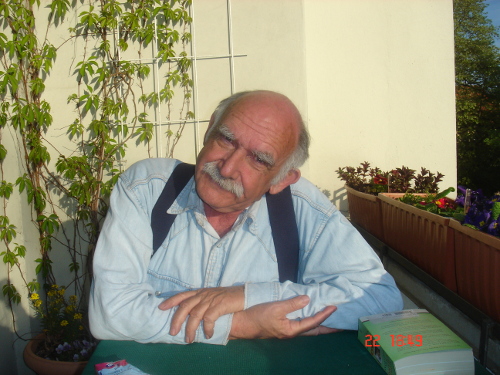
Erhard Stölting war bis 2009 Prof. für allgemeine Soziologie an der Universität Potsdam. Er beschäftigte und beschäftigt sich vor allem mit der Geschichte der Sozialwissenschaften, mit gesellschaftlichen Umbrüchen, mit den klassifikatorischen, emotionalen und ästhetischen Strategien des Aufbaus und der Zerstörung von Machtbeziehungen und Institutionen. Gegenwärtig schreibt er an Texten zum Begriff des „Umbruchs“, zu Lucien Goldmann in seiner Zeit, zu Ferdinand Tönnies und zur Illusion.
Im Kontext des Netzwerkes richtet sich seine Aufmerksamkeit auf die Möglichkeiten aus Bildern und Bildpraktiken Schlüsse auf Machtverhältnisse und verbreitete Formen der Überredung zu entwickeln.
Themenbezogene Publikationen
Stölting, Erhard (1995): Der Regen, Lesser Urys Bilder, Ruinen und Nostalgie. Variationen über ein Thema Georg Simmels. In: S. Lahren; O. Weißbach (Hrsg.): Konturen des Gemeinsinns. Festschrift für Peter Furth zum 65. Geburtstag. GFST: Berlin, S. 41-45.
Stölting Erhard, Der exemplarische Dandy. Soziologische Aspekte des schönen Scheins. In: K.-H. Barck; R. Faber (Hrsg.): Ästhetik des Politischen – Politik des Ästhetischen, Könighausen & Neumann: Würzburg 1999. S.. 35- 55.
Stölting, Erhard (2000): Projektive Faszination und die soziale Konstruktion von Individualität. In: Sozialer Sinn: Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung 1, S. 121-133.
Stölting, Erhard (2013): Illusion und Nachempfindung. Über mimetische Identifikation anhand von Arthur Schnitzlers Revolutionsstück „Der grüne Kakau“. In: I. U. Paul & R. Faber (Hrsg): Der historische Roman zwischen Kunst, Ideologie und Wissenschaft, Königshausen & Neumann: Würzburg. 2013, S. 371 – 390.
Carnap Anna/Dreke, Claudia/Gall-Prader, Maria/Kanter, Heike/Philipps, Axel/Stölting, Erhard/Stützel, Kevin/Wopfner, Gabriele (2015). Die ‚rechte Mitte‘ im Bild – Eine rekonstruktive Bildanalyse zum NSU. In: sozialersinn. Zeitschrift für hermeneutische Sozialforschung, 16(1), S. 3-25.